Wie giftig ist Kerosin von Flugzeugen in der Luft? Wie giftig ist es vor allem, wenn es tonnenweise von Flugzeugen ab gelassen wird? Seit Jahren kommen weder die Messungen über die Reststoffe in der Luft voran noch Maßnahmen dagegen – nun forderten die Freien Wähler im Mainzer Landtag erneut mehr Messstellen und bessere Vorsorge der Bevölkerung. Sie forderten vergeblich. Das Problem betrifft auch Mainz, klagen doch hier immer wieder Anwohner über Kerosingestank in der Luft und Schlieren auf Dachfenstern und Regentonnen. Nach Ansicht der Fluglärmgegner der Mainzer IKUL ist Kerosin der Hauptverursacher des giftigen Ultrafeinstaubs – und die Reste dieser Abgase kommen sehr wohl am Boden an.

Es war am 30. Juni, als eine Passagiermaschine 15 Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz in die Luft abließ. Wie der SWR recherchierte, flog der Pilot dafür eine große Schleife von Heidelberg über Kaiserslautern, bis er vor allem wohl über dem Pfälzerwald Tonnen seines Flugbenzins in die Luft abließ – in einer Höhe von knapp 9.500 Metern oder laut deutscher Flugsicherung im Sinkflug ab 31.000 Fuß. Der Vorgang war offiziell erlaubt und genehmigt, der Pilot hatte einen medizinischen Notfall geltend gemacht. Um das Gewicht der Maschine zu reduzieren, wurde das Flugbenzin abgelassen – es war beileibe nicht der erste Vorfall dieser Art.
Seit Jahren wird gerade über wenig besiedelten Gegenden in Rheinland-Pfalz Flugbenzin im großen Stil abgelassen. Mal sind es 15 Tonnen, mal 22 Tonnen, wie etwa am 11. Juni über dem westlichen Rheinland-Pfalz. Mitte Mai blies ein Flieger gleich 30 Tonnen Kerosin in die Luft, den Ort gibt das Luftfahrtbundesamt mit „westliches Rheinland-Pfalz – Südhessen“ an. Betroffen ist oft der Pfälzerwald, aber auch Hunsrück, Eifel, Westerwald, und sogar über Rheinhessen kam es schon zum sogenannten „Fuel Dumping.“
Bis heute ist indes ungeklärt: Was passiert eigentlich genau mit dem Kerosin in der Luft? Wohin gehen die Tonnen an giftigem Flugbenzin – und wie viel kommt davon am Boden an? Das Land Rheinland-Pfalz wiegelt seit Jahren ab: Das Benzin löse sich weitgehend in der Luft auf, am Boden komme davon so gut wie nichts an, heißt es in einem FAQ beim Mainzer Klimaschutzministerium: Bei einer „Worst-case-Betrachtung“ kämen bei Windstille und einer Bodentemperatur von 15 Grad Celsius etwa acht Prozent der insgesamt abgelassenen Treibstoffmenge am Erdboden an man errechne „eine theoretische maximale Bodenbelastung von 0,02 Gramm Kerosin pro Quadratmeter.“
IKUL: Reste von Kerosin kommen am Boden an
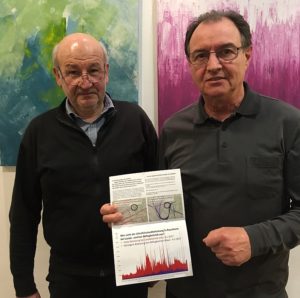
Für Fachleute ist das wenig glaubhaft: „Man muss davon ausgehen, dass Reste von Kerosin am Boden ankommen“, sagt Joachim Alt, Ingenieur und Experte für Luftschadstoffe bei der Initiative Klima, Umwelt und Lärmschutz im Luftverkehr (IKUL), im Gespräch mit Mainz&. Beim Fuel Dumping sei sogar ganz offiziell „zugelassen, dass am Boden bestimmte Menge ankommen dürfen“, erklärt Alt, und betont: „Die Abgase und der ganze Cocktail an Schadstoffen, der damit verbunden ist – die kommen bei uns am Boden an.“
Alt ist seit Jahren Experte für Ultrafeinstaubmessungen rund um den Frankfurter Flughafen, gemeinsam mit seinem Kollegen Wolfgang Schwämmlein deckte er 2015 durch Messungen immens hohe Konzentrationen von Ultrafeinstaub rund um den Frankfurter Flughafen und auch in Mainz auf – verursacht von den Fliegern. Die Ultrafeinen Partikel (UFP) gelten als hochgradig giftig und stehen im Verdacht, Gefäßkrankheiten bis hin zu Herzinfarkten auszulösen. Selbst das Hessische Landesamt für Umwelt „sagt inzwischen, 80 Prozent des UFP-Ausstoßes hängt mit dem Flugbetrieb zusammen“, sagte Alt nun im Gespräch mit Mainz&.
In München hätten Messungen sogar ergeben, „dass die UFP-Werte mit dem Flugbetrieb einhergehend bis zu 95 Prozent ausmachen“, berichtet Alt weiter. Das hätten Vergleichsmessungen während des Corona-Lockdowns ergeben – in den Monaten ohne Luftverkehr, vor allem im Frühjahr 2020 fiel auf, wie klar und sauber die Luft war. „Was an Feinstaub hier unten ankommt, ist zum Teil unverbranntes oder schlecht verbranntes Kerosin“, betont Alt und kritisiert: Gemessen werde das bis heute nicht. Dabei klagen auch in Mainz seit Jahren Anwohner in den Einflugschneisen Richtung Frankfurt über Kerosingestank in der Luft und ölige Schlieren auf Dachfenstern oder Regentonnen – gemessen wird das bis heute nicht.

Tatsächlich ist der Nachweis von Kerosin in der Luft nicht einfach, auch gibt es bislang keinerlei Grenzwerte für den Stoff, betont man beim Land Rheinland-Pfalz. „Trotz der nicht geforderten Messverpflichtung“ werde im ZIMEN-Messnetz des Landesamtes für Umwelt an insgesamt neun Stationen in Rheinland-Pfalz gemessen, im April 2019 seien im Westerwald und im Hunsrück zusätzlich zur bereits bestehenden Messstation im Pfälzerwald zwei weitere Messstationen mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet worden. „Dadurch wurde der Messumfang des Messnetzes gebietsbezogen erweitert und optimiert“, heißt es weiter.
Doch gemessen wird nicht etwa der Abgas-Cocktail des Flugbenzins, in dem unter anderem Schwefelstoffe und eben die genannte UFP-Partikel eine wichtige Roller spielen. Gemessen wird an den neun Stationen die Kohlenwasserstoffkonzentration – doch diese Kohlenwasserstoffe werden hauptsächlich von Verkehr und Industrieanlagen verursacht. Eine Unterscheidung, welche Stoffe nun aus dem Verkehr stammen, und welche von Fliegern aus der Luft ist nicht möglich.
Ministerin Eder fordert früher selbst Feinstaubmessungen in Mainz
So existieren in Mainz zwar gleich drei Messstationen des Ziemen-Netzes – in Mombach, in der Parcusstraße und auf der Zitadelle – doch CO2 und Schwefel werden hier einzeln gemessen, Ultrafeinstaub hingegen gar nicht. Alt, Schwämmlein und die IKUL fordern seit Jahren, dass UFP-Partikel auch in Mainz gemessen werden – vergeblich. Die damalige Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) forderte immer wieder das Land Rheinland-Pfalz auf, genau eine solche Messstation auch in Mainz einzurichten: „Ich will, dass gemessen wird“, sagte Eder noch im Dezember 2019 gegenüber Mainz& – seit Eder Klimaschutzministerin ist, ist davon keine Rede mehr.

„Es ist uns nicht bekannt, dass sich am Sachstand etwas geändert hätte“, sagte Alt nun gegenüber Mainz&: „Ministerin Eder reagiert auf Anfragen nicht.“ Mehrfach habe er eine Email geschickt und gebeten, „wir würden gerne an die Gespräche von damals anknüpfen“, berichtet Alt – eine Antwort habe es aber nie gegeben. Die IKUL aber bleibe bei ihrer Forderung: „Die Qualität der Luft muss viel stärker kontrolliert werden, und eben auch, was von den Stoffen am Boden ankommt.“
Das forderten am Donnerstag auch die Freien Wähler im Mainzer Landtag: In einem Entschließungsantrag forderten sie mehr Messstellen in Rheinland-Pfalz, eine Mindesthöhe bei Ablässen sowie Alternativ-Gebiete sowie eine Prüfung, ob das „Fuel Dumping“ überhaupt nötig ist oder vielleicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen passiert. „Rheinland-Pfalz ist überproportional von Treibstoffablässen betroffen“, betonte FW-Fraktionschef Joachim Streit. Dementsprechend habe die Landesregierung „gegenüber den Bürgern die Verpflichtung, überproportional vorsichtig mit diesem Sachverhalt umzugehen.“
Messstellen seien „kein Luxus“, eine klare Datenbasis zu den Kerosinablässen schaffe Sicherheit und Vertrauen in der Bevölkerung, betonte Streit weiter. „Wenn sie schon aufgrund ihrer Wohnlage unfreiwillig zu dem zweifelhaften Vergnügen kommen, tonnenweise mit Sprit bedacht zu werden, so sollte ihnen doch zumindest zugesichert werden, dass faktisch und messbar keine Gefahr für sie vor Ort durch die Kerosinbelastung besteht- das ist nicht zu viel verlangt!“, forderte Streit.

Zu wissenschaftlichen Studien gehöre eine ausreichende Datengrundlage, derzeit aber gebe es weiter Teile von Rheinhessen und anderen gebieten in Rheinland-Pfalz, in denen gar nicht gemessen werde. „Auf Lippenbekenntnisse können wir uns hier nicht mehr verlassen“, schimpfte Streit in einer Pressemitteilung der vergangenen Wochen.
Studie des Bundes liegt bis heute nicht vor
Tatsächlich hatte das Bundesumweltministerium im Jahr 2017 auf Drängen von Rheinland-Pfalz eine Studie zur Untersuchung der Kerosinablässe auf den Weg gebracht – die beim Bundesumweltamt in Auftrag gegebene Studie sollte eigentlich bis Mitte 2018 vorliegen – bis heute ist das Papier nicht veröffentlicht worden. „Leider hat das Bundesumweltministerium die Vorstellung der Studie immer wieder verschoben“, heißt es beim Mainzer Klimaschutzministerium. Es gebe aber eine Zusammenfassung in Form eines Positionspapiers, in dem es heiße, das Forschungsprojekt solle bis zum 30. Mai 2019 zum Abschluss gebracht werden.
Messungen wird die Studie ohnehin nicht enthalten: „Das Gutachten ist eine Meta-Studie und wertet aktuelle wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen von Fuel-Dumping aus“, heißt es beim Land. So sollten „mögliche Belastungssituationen sowie schädliche Umweltauswirkungen wie z.B. zum Abbauprozess, zum Sedimentationsverhalten und den daraus resultierenden bodennahen, unterschwelligen Belastungen (einschließlich des Grundwassers) – besser einschätzen zu können.“ Dumm nur: Fachleute klagten schon 2017, dass es kaum gute und aktuelle Studien gebe, die die Auswirkungen überhaupt untersuchten – und die es gebe, seien Jahrzehnte alt.

Im Mainzer Landtag fanden die Freien Wähler derweil nur Unterstützung bei der CDU-Opposition – SPD, grüne und FDP lehnten ihren Antrag ab. „Ich bin enttäuscht, dass das Land die geringen Kosten für weitere Messstellen im Sinne der Gesundheitsprävention rheinland-pfälzischer Bürger an den Bund weiterdelegieren möchte, statt selbst Verantwortung zu übernehmen“, kritisierte Streit. Man werde trotzdem weiter am Ball bleiben, um Klarheit und Transparenz zu erreichen. „Nur wo gemessen wird, wird es auch Ergebnisse geben“, betonte Streit.
Info& auf Mainz&: Mehr zum Thema Ultrafeinstaub und Flugverkehr haben wir ausführlich hier bei Mainz& berichtet. Die ganze Frage und Antwort-Sektion des Landes Rheinland-Pfalz zum Thema Kerosin-Ablässe findet Ihr hier im Internet. Mehr zum Stre9it um die Feinstaubmessungen in Mainz könnt Ihr noch einmal hier nachlesen:






