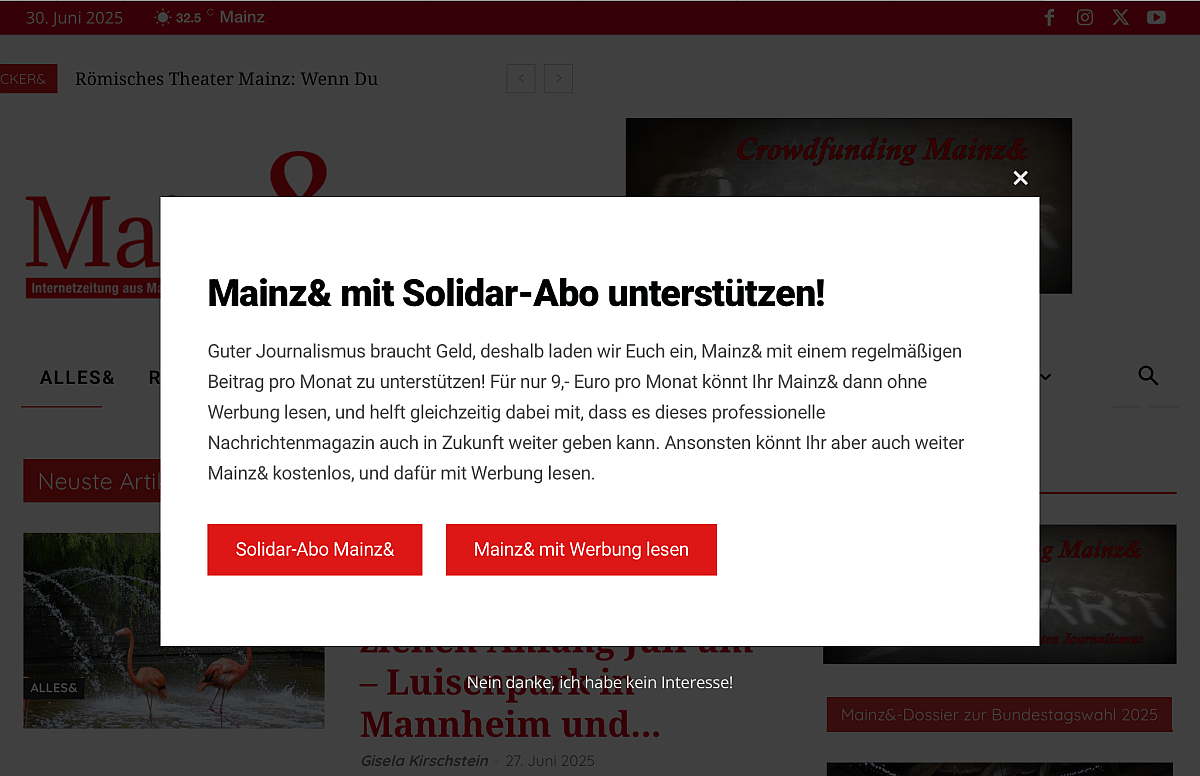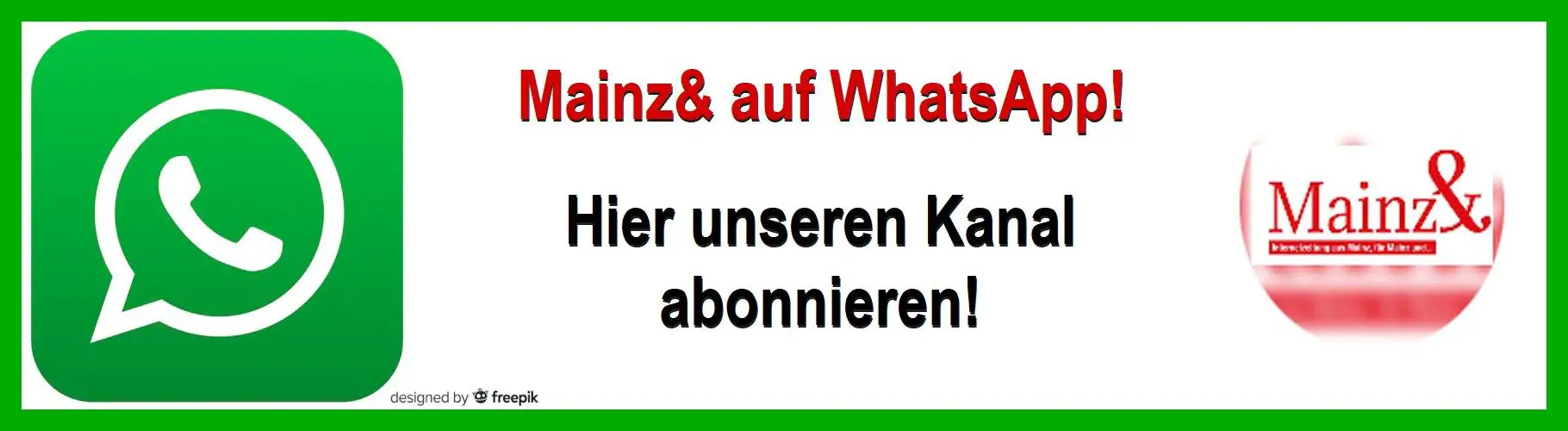Es war die bitterste Erkenntnis aus der Flutkatastrophe im Ahrtal: Der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz ist völlig ungenügend aufgestellt. Warnapps, die nicht warnten, Sirenen, die es nicht mehr gab, völlig überforderte Krisenstäbe und verzweifelte Feuerwehren, denen Fahrzeuge und Material, Wissen und Unterstützung fehlte. Vier Jahre danach zieht Mainz& Bilanz: Was hat sich getan im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz? Käme morgen erneut eine Flut – wären wir besser vorbereitet? Die Antwort lautet Jein: Ja, es hat sich einiges getan: neue Hubschrauber, ein neues Lagezentrum – aber die Warnketten sind immer noch die alten.

Es war im September 2024, als der Landtag in Mainz den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal vorlegte – es ist bis heute eine schonungslose Abrechnung mit den unvorstellbaren Versäumnissen der Behörden in der Flutnacht des 14. auf den 15. Juli 2021. Denn der Bericht belegt: Die Katastrophe wurde nicht nur vorhergesagt – den Landesämtern und Ministerien lagen bereits am Nachmittag des 14. Juli 2021 alle notwendigen Hinweise auf eine sich anbahnenden Katastrophe vor. Es gab Warnungen, Pegelstände, Augenzeugenberichte, zahllose Hilferufe aus dem Tal und schließlich sogar Fotos, die reihenweise untergegangene Häuser im Ahrtal zeigten.
Der Abschlussbericht dokumentiert minutiös, wie Informationswege in der Flutkatastrophe versagten, Handlungen „auf morgen“ verschoben wurden, gravierende Hinweise auf eine Katastrophe schlicht ignoriert, Medien eben gerade nicht informiert wurden, und sich Minister und Ministerpräsidentin ins Bett begaben, anstatt auf die Kommandobrücke. Und er zeigt auf, dass der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz überhaupt nicht auf dem neuesten Stand _ weder von Mensch noch von Technik -, und deshalb auf solche Ereignisse höchst unzureichend vorbereitet war.
Neu: Landesamt für Katastrophenschutz mit Lagezentrum
Dem Land fehlten Hubschrauber mit Rettungswinden, den Feuerwehren vor Ort Unimogs und geländegängige Fahrzeuge, den Gemeinden Sirenen zum Warnen – und allen ein Telefonbuch mit Kontakten zu den Medien. Im Krisenstab in Ahrweiler saßen Ehrenamtler zusammen, die noch nie in einem solchen Krisenstab gearbeitet hatten – darunter gestandene Feuerwehrleute – und die schlicht nicht wussten, wie man wichtige Warnsysteme bedient – allen voran das zentrale Warnsystem MoWas. Auf Landesebene wiederum existierte gar kein Krisenstab, der die Einsatzleitung hätte übernehmen können, das Lagezentrum im Innenministerium beschränkte sich darauf, Informationen für den Lagebericht des Ministers zu sammeln – einen Krisenstab in der Krise gab es nicht.

„Würde sich heute, zwei Jahre danach, wieder eine solche Katastrophenflut in Rheinland-Pfalz ereignen – wären wir heute besser vorbereitet?“, fragte Mainz&-Chefredakteurin Gisela Kirschstein Ende 2023 in ihrem Buch „Flutkatastrophe Ahrtal – Chronik eines Staatsversagens“? Der Katastrophenschutz in Deutschland brauche „eine Zeitenwende. In Material, Ausrüstung und Denken“, heißt es in dem Buch – vier Jahre nach der Flutkatastrophe ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: Welche Weichen hat das Land Rheinland-Pfalz inzwischen gestellt, was hat sich verändert – und was noch immer nicht?
Die wichtigsten Konsequenzen aus der verheerenden Flutkatastrophe: Die Anschaffung zweier Hubschrauber mit Rettungswinden, die im August 2024 vorgestellt wurden – und das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz (LfBK). Zum 1. Januar 2025 nahm das neue Landesamt in Koblenz seine Arbeit auf, dreieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Sein Herzstück ist ein Lagezentrum, in dem alle wichtigen Informationen zu Gefahrenlagen in Rheinland-Pfalz zusammenlaufen sollen – und das seit dem 1. Juni 2025 im durchgehenden 24-Stunden-Betrieb arbeitet. Vier Jahre nach der Flutkatastrophe beobachtet damit erstmals in Rheinland-Pfalz ein Lagezentrum permanent sämtliche Krisenparameter – von Wetter über sonstige Krise und Großschadenslagen.
Neues Lagezentrum: 24/7-Beobachtung aller Krisen
„Im Ernstfall noch schneller und flexibler reagieren zu können – das ist ein wichtiges Ziel der Neuaufstellung unseres Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz“, betonte Innenminister Michael Ebling (SPD): „Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sich das Lagezentrum unseres Landesamtes nun im Dauerbetrieb befindet, und die Lage in ganz Rheinland-Pfalz 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Blick behält.“ Die Mitarbeiter führten dabei rund um die Uhr Kompetenzen und Kräfte im ganzen Land zusammen. Im Ernstfall sollen hier Experten aus allen Bereichen zusammenarbeiten, und so schnell handlungs- und entscheidungsfähig sein – und zudem in direktem Austausch mit den Integrierten Leitstellen im Land stehen.

„Damit stärkt Rheinland-Pfalz seine Reaktionsfähigkeit bei Großschadenslagen und setzt bundesweit Maßstäbe“, betonte Ebling weiter: Als erstes Flächenland betreibe man „ein dauerhaft besetztes Lagezentrum für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr.“ Tatsächlich soll das neue Landesamt aber noch viel mehr leisten, wie im August 2022 der damalige Innenminister Roger Lewentz (SPD) ankündigte: Das Landesamt soll permanent den Kontakt zu übergeordneten Einrichtungen des Bundes halten, Alarm- und Einsatzpläne auf Landesebene entwickeln, Ausrüstung für den Katastrophenschutz zentral vorhalten sowie für Aus- und Weiterbildung der Kräfte vor Ort sorgen.
Die Flutkatastrophe hatte überdeutlich gezeigt: In Sachen Katastrophenvorsorge hatten die Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz jahrelang ihre Hausaufgaben nicht gemacht – und das Land hatte dies auch nicht kontrolliert. Vor Ort fehlten Alarm- und Einsatzpläne, obwohl sie eigentlich von Landesseite aus vorgeschrieben sind, die Ausstattung mit Katastrophenschutzzentren vor Ort ist höchst unterschiedlich, auch der Ausbildungsstand ließ vielerorts zu wünschen übrig. Ein wichtiger Faktor dabei: Rheinland-Pfalz setzt weiter auf Ehrenamtler und Freiwilligkeit beim Katastrophenschutz vor Ort – im Ahrtal ging genau das gründlich schief.
Ab 2026 hauptamtliche Katastrophenschutzinspekteure
Das soll sich nun wenigstens in Teilen ändern: Flächendeckend sollen nun in Rheinland-Pfalz hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteure eingeführt werden – wenn auch erst ab 2026 -, auch eine Fachaufsicht über die unteren Katastrophenschutzbehörden, also die Kreise und Städte, soll es nu endlich geben. Das sieht das neue Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vor, das der Mainzer Landtag Mitte Juni 2025 verabschiedet hat. Innenminister Ebling sprach dabei von „einem Meilenstein in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes“: Mit dem Gesetz schaffe das Land „professionelle Strukturen, setzt auf ein kluges Zusammenspiel zwischen Land und Kommunen und macht den Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz zukunftsfähig.“

Künftig gebe es „klare Zuständigkeiten, moderne Strukturen“ und mehr finanzielle Unterstützung, lobte der Minister – doch die Opposition fand prompt Kritikfähiges, gerade beim Thema „klare Strukturen“. Denn im Grundsatz bleiben auch in Zukunft die Kommunen zuständig für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und eben auch den Katastrophenschutz. „Das Land kann diese jederzeit unterstützen und in besonderen Ausnahmefällen, etwa bei großflächigen Katastrophenlagen, kann das Land auch selbst die Einsatzleitung übernehmen“, betonte Ebling – es gebe dafür jetzt „ein gestuftes Unterstützungssystem.“
Das Problem dabei: Die Frage, wann genau das Land bei einer Großschadenslage die Einsatzleitung übernimmt, ist weiter nicht klar geregelt. Dass das neue Katastrophenschutzgesetz wieder keine Einsatzübernahme durch das Land bei Großschaden zwingend vorschreibe, sei falsch, kritisierte CDU-Landeschef Gordon Schnieder gerade im Interview mit Mainz&: „Wenn zwei Landkreise flächendeckend betroffen sind, MUSS das neue Lagezentrum im Landesamt für Katastrophenschutz die Einsatzbewältigung übernehmen!“
Wann genau übernimmt das Land die Einsatzlage?
Auch Stephan Wefelscheid, Obmann der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal, kritisiert diesen Punkt deutlich: „Ein großer Kritikpunkt aber bleibt, dass das Land nur dann per Gesetz die Einsatzleitung hat, wenn es sich um einen radiologischen Katastrophenfall handelt“, schimpfte Wefelscheid – das war auch schon 2021 der Fall: Es bestehe die Gefahr, dass Kreise erneut überfordert würden, „und das Land wie in der Flutnacht nicht oder zumindest nicht rechtzeitig in die Bresche springt.“ In Katastrophenfällen, bei denen die Landkreise an ihre Grenzen und darüber hinaus gelangten, müsse das Land „seiner Verantwortung gerecht werden und ohne Wenn und Aber übernehmen“, forderte Wefelscheid.

Und dann ist da noch das Problem der Warnketten: Für die Herausgabe von Warnmeldungen an die Bevölkerung über Warnapps oder an die Medien gibt es das Modulare Warnsystem des Bundes, kurz „MoWaS“, doch genau das hatte in der Flutnacht erhebliche Lücken offenbart. Denn in den Dienststellen vor Ort wussten die meisten Einsatzkräfte nicht, wie MoWas zu bedienen ist, währenddessen wartete man in der Zentralen Leistelle in Koblenz auf die Anforderung aus dem Krisenstab in Ahrweiler, um den Katastrophenalarm der höchsten Stufe 5 auslösen zu können – man wartete vergeblich.
Und an diesem System, soll sich auch künftig nichts ändern, kritisierte Wefelscheid nun: Für eine Aktivierung einer Warnmeldung müsse auch weiter „ein zweiseitiges Meldeformular durch eine befugte Person ausgefüllt, unterschrieben und per Fax oder Mail an die zuständige Leitstelle geschickt werden“ – genau das hatte in der Flutnacht in keinster Weise funktioniert. Im Krisenstab in Ahrweiler fühlte man sich dem System nicht gewachsen, in Koblenz traute sich niemand, den Alarm trotzdem auszulösen: Man sei dazu nicht berechtigt gewesen, habe zudem keine Ortskenntnis gehabt, habe nicht wissen können, welche Handlungsanweisung die richtige sei. Einfach zu schreiben „Bringt Euch in Sicherheit möglichst weit nach oben“ – das ist in Deutschland nicht vorgesehen.
Warnsystem MoWas: Weiter Alarmanforderung per Fax
„Entscheidende Warnmeldungen, die zumindest zur Bewahrung von Menschenleben beigetragen hätten, sind nicht versandt worden“, klagte Wefelscheid: Das System via MoWaS sei „antiquiert, entspricht nicht dem Stand der Technik und versagt schlimmstenfalls gerade dann, wenn die Einsatzleitung an ihre Grenzen kommt. Da wäre es dringend geboten, die Warnkette zu überprüfen und warnungsauslösende Instrumentarien zu aktualisieren.“ Doch das Land Rheinland-Pfalz könne auch vier Jahre nach der Flutkatastrophe „nicht sagen, wann die Überarbeitung des Rundschreibens, in dem die Aktivierung von MoWaS geregelt ist“ kommen werde, klagt Wefelscheid: „Das ist ein Armutszeugnis!“

Denn es war gerade ein Rundschreiben aus dem Mainzer Innenministerium aus dem Jahr 2020, das die Meldekette und Alarmierungsmodalitäten von MoWas so verbindlich festlegte, dass sich niemand traute, dagegen zu verstoßen. Das Rundschreiben „Herausgabe von Warnmeldungen über das Modulare Warnsystem MoWaS“ enthalte „nach wie vor die wesentlichen Regelungen und besitzt daher grundsätzlich Gültigkeit“, antwortete das Innenministerium jetzt auf Wefelscheids Anfrage. Man nehme aktuell „eine Überarbeitung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Enquete-Kommission und dem Untersuchungsausschuss“ vor, wann die aber abgeschlossen sei, lasse sich derzeit noch nicht genau sagen.
Unter anderem würden derzeit „Vorlagen für Warntexte erarbeitet“, die allen Warnverantwortlichen zur Verfügung gestellt würden. Die Nutzer der MoWaS-Systems verfügten zudem „über die Anweisung ‚Medien‘ vom 03.11.2022“, die bereits unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Naturkatastrophe von 2021 geschrieben worden sei. Grundsätzlich aber gelte weiter, dass die Leitstellen die via MoWas eingehenden Warnmeldungen „vor Herausgabe der konkreten Warnung an die Bevölkerung überprüfen und bei Bedarf unverzüglich Rücksprache mit dem Meldenden halten“, betonte Innenminister Ebling weiter: „Somit ist hier gemäß der bestehenden Anweisung eine Kontrollinstanz zwischengeschaltet, welche in einer Stresssituation Sicherheit gibt.“
Einsatzpläne, Verwaltungsstäbe – aber weiter Hürden beim Warnen
In der Flutkatastrophe führte genau dieses „Zwischenschalten“ allerdings vor allem zu einem: Dass niemand den Katastrophenalarm auslöste, niemand eine Warnung an die Bevölkerung herausgab. Statt Sicherheit gab es Leerlauf und Verzögerung: Ab 17.00 Uhr wussten sie im Krisenstab in Ahrweiler, dass eine Hochwasserflut von mehr als fünf Metern drohte, gegen 19.45 Uhr gibt Landrat Jürgen Pföhler (CDU) sogar noch eine Pressemitteilung zur zunehmend dramatischen Lage im Ahrtal heraus – die Entscheidung, den Katastrophenalarm samt Evakuierungen auszulösen, fällt dennoch erst gegen 22.10 Uhr.

Es dauert eine weitere Stunde, bis im Krisenstab in Ahrweiler der eine Beamte zu greifen ist, der MoWas bedienen und die Meldung nach Koblenz auslösen kann – erst um 23.09 Uhr geht der Alarm raus – viel zu spät, und in ihrer Konsequenz längst überholt. „Der Zeitverzug am 14.7.“, bilanziert später der Hochwasserexperte Dietrich, „war lebensrelevant.“ Oder anders gesagt: Mit rechtzeitigen Warnungen hätten gerade an der unteren Jahr Dutzende Menschenleben gerettet werden können.
Immerhin: Das neue Brand- und Katastrophenschutzgesetz verpflichtet die kommunalen Aufgabenträger künftig, „regelmäßig Bedarfs- und Entwicklungspläne zu erstellen, fortzuschreiben und nun auch der Aufsichtsbehörde vorzulegen“, wie man im Innenministerium betont. Auch ist nun ein Zwei-Stabsmodell verbindlich vorgeschrieben,. also die Einrichtung eines Operativ-Taktischen Stabes sowie eines Verwaltungsstabes, Letzterer ist für die Vorbereitung von Evakuierungen und die Betreuung der Bevölkerung in einer Katastrophe zuständig – und einen Verwaltungsstab hatte man in Ahrweiler gerade nicht. Erstmals wird nun auch die psychosoziale Notfallversorgung gesetzlich geregelt.
Warnketten weiter anfällig für Ausfälle – Zeitenwende? Noch nicht
Zur Unterstützung der Umsetzung stellt das Land für 2026 und 2027 zusätzlich rund 7,3 Millionen Euro bereit, etwa für die Einführung hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteure und für die Aufstellung der Pläne in den Kommunen. Investiert hat das Land auch in den Wiederaufbau von Sirenenanlagen: Insgesamt stehen für den Aufbau dieser modernen Warnsysteme 13,8 Millionen Euro bereit, heißt es in einer aktuellen Meldung des Innenministeriums – davon kommen 5,3 Millionen Euro vom Bund und 8,5 Millionen Euro vom Land. Ausgezahlt sind bislang aber nur rund 6,8 Millionen Euro.

Immerhin: Die Kommunen in Rheinland-Pfalz verfügen inzwischen wieder über 3.458 betriebsbereite Sirenen, davon wurden 869 nach der Flutkatastrophe im Ahrtal neu errichtet. „Sirenen sind ein bewährtes und effektives Warnmittel, das die Bevölkerung im Ernstfall schnell erreicht“, heißt es nun wieder: „Sie werden akustisch zuverlässig als Warnsignal verstanden und sind damit Bestandteil eines robusten Warnmittel-Mixes.“ Zu dem gehört seit Dezember 2022 nun auch endlich das Cell Broadcasting-System: Dabei gelangen Warnmeldungen automatisch und unabhängig von Warnapps aufs Handy, erst zwei Jahre später, zum Warntag 2024 funktionierte das flächendeckend reibungslos.
Wie anfällig die Warnketten noch immer sind, zeigte zudem gerade erst der erste landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz im März 2025: Während das Cell Broadcasting reibungslos klappte, und auch Sirenen und die Warnapp NINA pünktlich warnten, kam es beim Ausspielen der Warnmeldungen auf die App Katwarn zu einer schweren Panne. Mitgeteilt wurde das der Presse allerdings nur über das Land Hessen, das gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Warntag abhielt – in Mainz sprach man dagegen von einem erfolgreich absolvierten Test.
Bleibt also das Fazit: Die Aufrüstung bei Material und Ausstattung im Katastrophenschutz hat begonnen – eine Zeitenwende im Denken ist aber weiter nicht auszumachen. „Warnen können wir nicht“, sagte 2021 der Mainzer Brandmeister Michael Ehresmann, die Frage bleibt, was sich daran grundsätzlich geändert hat. Viele Feuerwehrleute vor Ort sind definitiv heute sensibler, gehen mit Warnungen der Bevölkerung bewusster um – was sie brauchen, ist die Rückendeckung von Vorgesetzten, dass auch mal etwas schief gehen kann. Und Systeme, die Warnungen erleichtern und nicht erschweren.
Info& auf Mainz&: Mehr zum Thema „Warnen können wir nicht“ lest Ihr ausführlich auch hier bei Mainz&.
Zum 4. Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal sendet Mainz& eine Artikelserie – wir wollen Bilanz ziehen, Entwicklungen berichten und haben Interviews geführt. Diese Teile sind bisher erschienen (wird ergänzt):
- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal: Der verzweifelte Kampf um Gerechtigkeit – Disziplinarverfahren gegen Pföhler, aber weiter keine Anklage
- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal, CDU-Chef Gordon Schnieder: „Für eine Entschuldigung des Staates ist es nie zu spät“
- Vier Jahre Flutkatastrophe Ahrtal: Hätte die EU in der Katastrophe helfen können? – Streit: EU-Notfallhilfe nicht beantragt