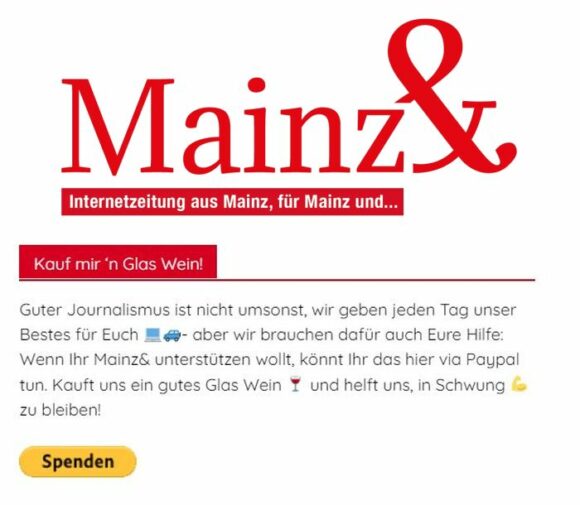— Artikel vom 08. Mai 2025– Wie könnte ein Konzept für die Präsentation und Vermarktung des römischen Erbes in Mainz aussehen? Nach jahrelangem Stillstand von Seiten der Politik, legt nun eine Arbeitsgruppe um den früheren Landesarchäologen Gerd Rupprecht einen eigenen Konzeptansatz vor. Ausgangspunkt ist der Ärger über die „Verwahrlosung“ der römischen Denkmäler, den die Gruppe bereits im Sommer 2024 anprangerte – damals aufgehängt an den Römersteinen in Mainz-Zahlbach. Nun gibt es eine ganze Broschüre mit einer Bestandsaufnahme zu 32 römischen Denkmälern – und einem neuen Ansatz zur Präsentation.

Es war im Februar 2025, als vier altgedienten Mainzer Bürgern aus dem Bereich Kultur und Denkmalpflege der Kragen platzte: Der praktische Umgang mit den antiken römischen Denkmälern im öffentlichen Raum sei „beschämend“, viele Denkmäler ungepflegt, die Umgebung verwahrlost, viele Informationsstelen „in einem jämmerlichen Zustand“. Kurz: Der Umgang mit dem reichen antiken Erbe der Römerstadt Mogontiacum sei lieblos und vor allem konzeptionslos – das könne so nicht bleiben.
Die vier Herren sind nicht irgendwer: Der CDU-Politiker Peter Krawietz war anderthalb Jahrzehnte lang ehrenamtlicher Kulturdezernent von Mainz, Hartmut Fischer über Jahrzehnte der oberste Denkmalpfleger der Stadt Mainz und heute im Verein für rheinische Denkmalpflege engagiert. Christian Vahl wiederum ist Vorsitzender der Initiative Römisches Mainz und war Gründungpräsident der „Unsichtbaren Römergarde“, deren Mitglieder sich der Wiedersichtbarmachung von Verschwundenem verschrieben haben – insbesondere dem römischen Erbe von Mainz.
Verwahrlost, zugewachsen, ungepflegt: die Römersteine in Zahlbach
Auslöser für die Klage im Februar war der Zustand der Römersteine in Mainz-Zahlbach: Die großen Pfeilerreste einer antiken römischen Wasserleitung, die einst von Mainz-Finthen über die Felder von Bretzenheim und schließlich das Zaybachtal zum Legionslager auf dem Kästrich führte, präsentierten sich im Sommer 2024 in einem erbarmungswürdigen Zustand: Die Pfeiler überwuchert von Grünbewuchs und bedrängt von illegalen Zäunen und sogar einem Klohäuschen. Dazu gefährden bis heute Bäume, die aus dem Untergrund direkt an den Pfeilern wachsen, die Standfestigkeit der rund 2.000 Jahre alten Steinsäulen.

Die „Unsichtbare Römergarde“ schlug Alarm: Mit Fotos und Beschreibungen machten sie auf den verwilderten Zustand rund um die Steine aufmerksam, und brachten damit die zuständige Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) und die Gebäudewirtschaft Mainz kräftig auf Trab. Inzwischen präsentiert sich das Gelände rund um die Römersteine deutlich verbessert: Grünbewuchs wurde ausgedünnt, die Steine gereinigt, die Pfeilerreihe ist nun wieder von der Straße aus zu sehen.
Doch den Akteuren reichte das nicht: Sie nahmen in der Folge das sichtbare römische Erbe im Stadtbild von Mainz unter die Lupe – mit vernichtendem Ergebnis: Rund um 32 öffentlich zugängliche römische Denkmäler fanden sie Verschmutzungen und Schmierereien, mangelhafte Zugänglichkeit oder gar gar keine Sichtbarkeit mehr. Da ist etwa die große Mainzer Jupitersäule, mit 9,10 Metern Höhe und 28 Reliefs mit Abbildungen von römischen und keltischen Göttern die bedeutendste Siegelsäule ihrer Art, die jemals nördlich der Alpen gefunden wurde.
Antike Gräberstraße, Mauern, Denkmäler: vernachlässigt
Eine Nachbildung der von Mainzer Kaufleuten zwischen 63 und 67 nach Christus zu Ehren des römischen Kaisers Nero gestifteten Säule stand bis 2015 auf dem Platz vor dem Mainzer Landtag – dann verschwand die Säule zur Restauration. 2023 sollte sie eigentlich zurückkehren, geschehen ist das bis heute nicht, Informationen zur Rückkehr: keine. Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Großen Bleiche, steht eine Nachbildung des Dativius-Victor-Bogens, zwei Parkplatzschilder sind hier so platziert, dass sie mitten im Blickfeld auf den antiken Bogen stehen.

In einer Broschüre, die die vier Akteure nun an diesem Mittwoch in Mainz vorstellten, werden zahlreiche weitere solcher Beispiele aufgelistet. Da ist etwa der Rest einer römischen Mauer im Foyer des Mainzer Unterhauses, der als solcher den Besuchern so gut wie nicht erkennbar ist. Vor dem Alexanderturm in der Augustusstraße prangt ein riesiges rotes Werbetransparent, der römische Meilenstein hinter dem Kleinen Haus des Staatstheaters in der Fuststraße wird permanent von parkenden Autos umringt, die nicht einmal Abstand halten.
Überhaupt seien die Infostelen der Stadt Mainz in einem schlechten Zustand, kritisierte Denkmalpfleger Hartmut Fischer: Vielerorts seien Beschriftungen nicht mehr lesbar, andere Stelen mit Graffiti beschmiert. Schlimmer ergeht es noch vielen eigentlich wichtigen antiken Denkmälern im Stadtbild: Die alte Stadtmauer in der Hinteren Bleiche ist seit Jahren in einem verwahrlosten Umfeld, die antike Gräberstraße in Weisenau – „eines der bedeutendsten Denkmäler in Mainz“, so Fischer – in keinster Weise barrierefrei zugänglich.
Erstmals Gesamtkonzept für das Römische Mainz skizziert
Im Gonsbachtal wiederum wurden in den Jahren 2013 und 2014 die Reste einer antiken Villa Rustica samt mehrfarbigen Mosaikfußböden, Reste eines römischen Bades sowie der mögliche Dressurplatz für die Pferde der in Mainz stationierten Legionäre gefunden – das Areal ist heute fast völlig zugewachsen, von dem einstigen Gestüt praktisch nichts zu erkennen. So gebe es viele Beispiele für den Umgang mit dem Römischen Erbe im Mainzer Stadtbild, klagte Fischer. Die jetzige Bestandsaufnahme „kann man als einen anregenden Startschuss sehen, sich doch noch mal intensiver um die Bewahrung des Römischen Erbe zu kümmern“, empfahl er.

„Wir sind vier ältere Herren mit beruflicher und langjährige Erfahrung“, betonte derweil Krawietz, man habe sich „berufen geführt, uns mit dem römischen Mainz zu beschäftigen“ und sehe einen Handlungsbedarf. Das gilt aber nicht nur für den aktuellen Zustand der Römischen Denkmäler, sondern für den Umgang mit dem Erbe insgesamt: „Immer wieder wird nach einem Gesamtkonzept Römisches Mainz gefragt, das ja nur Teile eines gesamten Konzeptes für das historische Mainz sein kann“, betonte Krawietz weiter. Deshalb habe man sich „bemüht, eine Konzeption zu machen unter dem Titel Mainzer Kulturdenkmäler aus römischer Zeit und wende sich damit nun „an die Mainzer Öffentlichkeit.“
Denn das kleine Heftchen mit seinen 44 Seiten soll ab dem heutigen Donnerstag frei und kostenlos verfügbar im Stadthaus an der Großen Bleiche, in den Ortsverwaltungen sowie in der Touristinformation von Mainz ausliegen. Finanziert wurde es von der Arbeitsgruppe mit Hilfe von Spenden, die erste Auflage in Höhe von 1.000 Stück lasse sich jederzeit aufstocken, betonte Vahl.
Rupprecht: „Das ist nicht irgendwelcher Schrott“ im Stadtbild
Doch die Broschüre prangert nicht nur an, sie schafft unter dem sperrigen Titel „Das provinzialrömische Erbe im Mainzer Stadtbild“ erstmals auch eine fundierte Einordnung, unter welchen Überschriften und mit welchen Themenkreisen das antike Erbe von Mainz gesehen und präsentiert werden könnte. Das trägt natürlich die Handschrift von Gerd Rupprecht: Der langjährige Landesarchäologe gilt als „der Erwecker des römischen Mainz“, wie Krawietz am Mittwoch noch einmal betonte.

Zu seinem 80. Geburtstag im März 2024 verneigten sich Politik und Stadtgesellschaft vor dem Archäologen, natürlich in seinem „Wohnzimmer“: dem antiken Römischen Bühnentheater, das Rupprecht eigenhändig ausgrub. „Wenn von ‚Erbe‘ die Rede ist im Mainzer Stadtbild, so will man wissen: wer ist denn der Erbe?“, sagte Rupprecht am Mittwoch nun, und betonte zugleich: „Der Erbe ist die ganze Stadtbevölkerung, da kann sich niemand ausnehmen.“ Und dieses Erbe müsse so in Szene gesetzt werden, dass es in der Öffentlichkeit auch präsentabel sei.
Doch genau daran lasse es Mainz gravierend mangeln, klagte der Archäologe: „Es fehlt Pflege, es fehlt gestalterischer Esprit!“ Die Denkmäler seien ja „nicht irgendwelcher Schrott“, sondern durch Ausgrabungen gewonnene „wertvolle Informationen über unser aller Erbe“, betonte er. Und dabei sei das römische Stadtbild durch die Funde der vergangenen Jahre immer größer geworden, „sowohl auf dem Kästrich, als auch in der Südstadt und in der Neustadt zählen heute große Flächen dazu.“
Mogontiacum: 500 Jahre Zusammenspiel Militär und Zivilgesellschaft
Doch was fehlt, ist eine Einordnung dieser Funde in einem gemeinsamen Rahmen, und diese legt Rupprecht mit dem kleinen Bändchen nun in ein komprimierten Form vor: Denn während die Römerstadt Trier durch ihre große Bauten wie Porta Nigra oder Römerthermen geprägt sei, gebe es in Mainz „ein Jahrhunderte währendes und kulturhistorisch entscheidendes Zusammenspiel zwischen Militär- und Zivilgesellschaft“ – und das in einer einmaligen Form. Auch Mainz habe mit dem Bühnentheater, dem Isistempel, dem Drususstein und dem Aquädukt bedeutende Bauten, aber „der Grundgedanke der Interaktion zwischen Römern und Naturbevölkerung macht das Wesentliche des Römischen Mainz aus“, betonte Rupprecht.

Tatsächlich wurde das antike Mogontiacum ja gerade als Grenzstadt am Rhein und als Bollwerk gegen die Germanischen und keltischen Stämme auf dem anderen Rheinufer errichtet. Mogontiacum war nicht nur Provinzhauptstadt, sondern auch eines der wichtigsten Legionslager entlang des Rheins: Hier gab es die erste Brücke über den Rhein, dazu massive Patrouillen mit riesigen Militärschiffen, wie die in den 1980er-Jahren in Mainz gefundenen Römerschiffe belegen.
Und so setzt Rupprechts Konzept denn auch genau bei der Lagervorstadt und dem römischen Legionslager an, die just bei den Bauarbeiten zum neuen TRON-Forschungszentrum in der Oberstadt gefunden wurden: Das Zusammenspiel zwischen Militär und Zivilgesellschaft wird hier besonders deutlich, Mainz könnte als ein herausragendes Beispiel von Alltagsleben in einer römischen Provinzhauptstadt aufgearbeitet und präsentiert werden: „500 Jahre römisches Mainz stehen für Siedlungsformen und Bauweisen, für Kleidung und Tracht, für Brauchtum, Kult und Religion“, heißt es in der Broschüre.
Antikes Mainz: Handelszentrum, Politikmetropole, Medienzentrum
Besonders interessant seien dabei „die in Mainz realisierten wirtschafts- und handelsgeschichtlichen Strukturen und die dadurch ausgelösten Prozesse und Veränderungen im Verkaufe der Jahrhundert“, so der Text weiter. Kurz gesagt: Die Anwesenheit des Militärs und der von ihm mitgebrachten römischen Kultur hatte massive Auswirkungen auf das Leben der einheimischen Stämme – die römische Kultur kennenlernten und aufnahmen, es entwickelte sich ein reiches Netz von Handelswegen, sowohl zu Lande, als auch auf dem Wasser – mit erheblichen Folgen.

„Mainz wurde zum Handelsplatz und zur politischen Metropole“, zählt die Broschüre als einen wichtigen Aspekt auf – Mainz wurde damit aber auch zu einem Zentrum, an dem Informationsquellen zusammenliefen, „so dass es als historisches mediales Zentrum angesehen werden“ könne. Das lasse sogar „zwanglos einen Bogen spannen, der von der römischen Schrift und deren Verbreitung zu Johannes Gutenberg“ und seiner Druckkunst bis hin zu modernen Medienhäusern in Mainz spannen, so die Autoren.
Nicht zuletzt wegen seiner Funktion als Knotenpunkt in Handel und Transport, dürfte Mainz auch zum Zentrum der frühen römisch-katholischen Kirche geworden sein, wie die Ausgrabungen im „Alten Dom“ zu Mainz belegen – die ehemalige Johanniskirche gilt heute als eine der ältesten Kirchenbauten Deutschlands. Und schließlich ist das antike Mogontiacum nicht ohne Landwirtschaft denkbar – und nicht ohne den Wein: Gerade erst wurde zum ersten Mal eine antike römische Weinkelter im Nahetal wissenschaftlich nachgewiesen, damit steht fest, dass die Römer in Rheinhessen Weine produzierten.
Great Wine Capital Mainz: „römische Wurzeln zusprechen“
Die Entdeckung der antiken Weinkelter mit dem Beleg der Weinproduktion im Profi-Stil für das römische Alltagsleben berechtige sehr wohl dazu, der Great Wine Capital Mainz „ohne weiteres römische Wurzeln zuzusprechen“, konstatiert das Konzept. Damit eröffneten sich ganz neue Marketing-Optionen aus der Kombination von Wein, Genuss und Kulinarik – wie Römische Weinfeste oder Kelterfeste in Kombination mit dem Angebot von römischen Speisen. „Weinlandschaft und Weinkultur gewinnen so ein unverwechselbares Profil, dies wird den Wunsch, Mainz zu besuchen, die hiesigen Weine kennenzulernen und römische Speisen zu genießen, sicher fördern“, so das Konzept weiter.

Was nun aus dem Konzept werden soll? Das sei nun der Stadtgesellschaft und der Politik überlassen, meinten die Herren. „Wenn ich träumen dürfte, kann man sich auch kleine Dinge denken“, sagte Vahl: Eine regelmäßige Reinigung der Informationsstelen, ein besseres Sich-Kümmern für die Denkmäler, regelmäßige Begehungen. „Ich würde mir wünschen, dass sich unser Oberbürgermeister mal nach Trier einladen lässt“, sagte Vahl weiter – dort lasse sich nicht nur ein Präsentationskonzept für die Römerzeit besichtigen, sondern auch, wie dort große Fördersummen aus Bund und EU für die Umsetzung eingeworben wurden.
„Mit einem Gesamtkonzept könnte man Mittel nach Mainz bringen, die im Haushalt nicht vorhanden sind“, sagte Vahl: „Wir sind gerne bereit, für die Bedeutung des Römischen Mainz zu werben.“ Mit dem Büchlein wolle man „den Appetit auf das Römische Erbe wieder wecken, denn so schlecht wie heute sah es noch nie aus. Wir wollen die Faszination wecken, um sich wieder besser um das Römische Erbe zu kümmern.“ Denn egal ob Stadtbauten oder Handel, die Kirchen oder die Entwicklung im Mittelalter zur bedeutendsten Bischofsstadt des Reiches, „ohne die Römer wäre Mainz heute nicht das, was es ist.“
Info& auf Mainz&: Mehr zum Thema Römisches Erbe und der Forderung nach einer Römischen Stadtkuratorin für Mainz lest Ihr auch hier bei Mainz&.